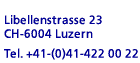
| Zurück | |
Home > Wissen > Lexikon > Grundbegriffe der Energiewirtschaft |
Um Text auf dieser Seite zu suchen, verwenden Sie die Suchfunktion von Ihrem Browser.
- Microsoft Internet Explorer
Bearbeiten > Suchen (aktuelle Seite) ...
- Netscape Navigator
Bearbeiten > Auf dieser Seite suchen ...
oder verwenden Sie die Tastenkombination Strg+F.
(Die Taste Strg (Control) und gleichzeitig die Taste F drücken)
Beachten Sie auch die anderen Lexiken und die weiteren Informationen (z.B. Lieferantenverzeichnisse) am Schluss dieser Liste.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bei dieser Seite handelt sich um ein Informationsangebot. Beachten Sie bitte auch die Rechtshinweise. Für Rückmeldungen, weitere Fragen oder Hinweise nehmen Sie mit dem Verfasser Kontakt auf.
Frage: Was genau heisst / bedeutet "Anergie"?
Antwort: Teil der Energie, welcher keine mechanische Arbeit zu leisten
vermag.
-> Weitere, zusätzliche Informationen
| Stichwort, Benennung | Definition | Quellenangabe | ||
| A |
|
|||
| Abdampf | Der nach Durchströmen einer Dampfmaschine oder Dampfturbine austretende Dampf. Er kann zur Wiederverwendung über einen Abdampfentöler, einen Kondensator und eine Kesselspeisepumpe zum Kessel zurückgeleitet werden, oder die in ihm enthaltene Wärmeenergie wird anderweitig, z.B. in einer Abdampfturbine, verwendet (Abwärme). | Brockhaus - Die Enzyklopädie: in 24 Bänden. Verlag: F.A. Brockhaus GmbH, Leipzig - Mannheim | ||
| Abwärme (Abfallenergie) | Die in einem energieverbrauchenden Prozess nicht nutzbare Wärme, insbesondere in Bereichen wo Wärme erzeugt und verwendet wird. Die Abwärme wird entweder im Wege der Energieentsorgung an die Umgebung abgeführt, oder wird über Wärmerückgewinnungsanlagen einer weiteren Nutzung zugeführt. Abwärmeträger sind z.B. Raumabluft, Kühlwasser, Abdämpfe, Abgase aus Oefen und Verbrennungsmotoren. Je nach Abwärmeträger und Temperaturniveau ergeben sich unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. (Siehe Wärmerückgewinnung, Abwärmenutzung). |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Anergie, Abwärme | Teil der Energie, welcher keine mechanische Arbeit zu leisten vermag | Energie-Fachbuch 1995 [13.2, Seite 240] | ||
| B |
|
|||
| Biogas | Gas, das aus der anaeroben Fermentation (Konversion ohne Lufteinfluss) von Biomasse hervorgegangen ist und aus einem Gemisch aus Methan und Kohlendioxyd besteht. Natürliche Biogasvorkommen, die z.T. genutzt werden, sind z.B. Stallmist-Gas und Moor Gas. | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Biomasse | Organische Stoffe nicht fossiler Art aber biologischer Herkunft. Biomasse wird zum Teil zur Gewinnung von Energie genutzt (Holz, Holzschnitzel und andere Sägenebenprodukte, Schlamm aus Kläranlagen, Stallmist und Jauche, Abfälle aus Land- und Forstwirtschaft, etc.). Biomasse wird entweder im Verbrennungsprozess direkt zur Gewinnung von Wärme genutzt (sog. Energieholz: Stückholz, Schnitzel, Späne) oder in verschiedenen thermochemischen oder biologischen Umwandlungsverfahren (Biokonversion; z.B. anaerobe Fermentation, etc.) in eine nutzbare Energieform umgewandelt (Holzkohle, Biogas, Ethanol-Alkohol, etc.). Der energetischen Nutzung von Holz sind allerdings relativ enge Grenzen gesetzt, damit die Wälder, deren Aufbau u.U. Generationen gedauert hat, als erneuerbare Energiequelle dauernd erhalten werden können. | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Brodem | Von heissen wässrigen Flüssigkeiten aufsteigender Dunst, Dampf. | Brockhaus - Die Enzyklopädie | ||
| Brüden | Brüden, bei techn. Prozessen: der beim Eindampfen einer Lösung entweichende Dampf. Die Kondensationstemperatur des Brüdens liegt niedriger als die Siedetemperatur der Lösung. Siehe auch Brodem. | Brockhaus - Die Enzyklopädie | ||
| Brüdenkompression | Unter Brüdenkompression versteht man eine Maßnahme zur Verbesserung des Wärmehaushalts einer Verdampferanlage. Dabei werden die Brüden mit einem Kompressor verdichtet. Durch den höheren Druck wird die Kondensationstemperatur des Dampfes erhöht. Die Kondensation kann dadurch bei der Siedetemperatur der Lösung durchgeführt und die Kondensationswärme zum Verdampfen der Lösung ausgenutzt werden. Siehe auch Brüdenverdichtung. | Brockhaus - Die Enzyklopädie | ||
| Brüdenverdichtung | Ein Destillationsverfahren unter Ausnutzung des Wärmepumpenprinzips. Energetisch aufwendige Destillationsverfahren können wesentlich kostengünstiger gestaltet werden, wenn die den Kopf der Kolonne verlassenden Dämpfe, die Brüden, mit einem Kompressor verdichtet und die so überhitzten Brüden zur Heizung des Sumpfes der Kolonne benutzt werden. Dabei werden der Heizdampf der Kolonne und das Kühlwasser für den Destillatkühler eingespart, lediglich die geringe Antriebsenergie des Kompressors muss aufgebracht werden. Siehe auch Brüdenkompression. | Lexikon der Chemie. Verlag: Spektrum Akademischer Verlag GmbH | ||
| C |
|
|||
| D |
|
|||
| Dampf | Dampf, Stoff im gasförmigen Zustand, wenn er mit seiner flüssigen oder festen Phase im Wärmegleichgewicht steht, also etwa der über einer Wasseroberfläche verdunstende und im gleichen Umfang wieder kondensierende Wasserdampf. Im geschlossenen Gefäss stellt sich bei bestimmter Temperatur zwischen Verdampfen und Kondensieren ein Gleichgewicht ein (gesättigter Dampf, Sattdampf). Von der Flüssigkeit abgesperrter, höher erhitzter Dampf heißt Heissdampf (überhitzter Dampf). | Der Brockhaus in einem Band, 9. vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. | ||
| E |
|
|||
| Einsatzenergie | Die beim Verbraucher unmittelbar vor der letzten Umwandlungsstufe
(der Umwandlung zu Nutzenergie) bereitgestellte Energie. Einsatzenergie
ist also z.B. der Strom, welcher der Klemme des Elektromotors oder
der Glühlampe zugeführt wird, oder das Warmwasser, welches
in den Heizkörper strömt. (Statt Einsatzenergie wird gelegentlich auch der Begriff Gebrauchsenergie verwendet.) |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Endenergie | Die Energie, welche vom Endverbraucher (z.B. einem Industriebetrieb, einem Gebäude, einem Haushalt) zum Zwecke der weiteren Umwandlung und Nutzung bezogen bzw. eingekauft wird. Beispiele: Heizöl, Erdgas, Fernwärme (als Heisswasser oder Prozessdampf), die aus dem Netz bezogene Elektrizität, die vom Betrieb energetisch genutzten Industrieabfälle. Als Endenergieträger werden also alle Energieträger verstanden, welche vom Endverbraucher zur Deckung seines Energiebedarfes eingesetzt werden. Nicht darunter fallen die Energieträger, die für den nicht-energetischen Verbrauch eingesetzt werden (z.B. in der chemischen Industrie). Anmerkung: Endenergie wird manchmal allgemeiner definiert als die Energie, welche dem Verbraucher vor der letzten Umwandlung (zu Nutzenergie) zur Verfügung gestellt wird. Im Rahmen der betrieblichen Energieversorgung und des vorliegenden Kompendiums ist es jedoch zweckmässig zu differenzieren zwischen der vom Betrieb eingekauften/ bezogenen Energie (Endenergie gemäss obiger Definition) und der vor der letzten Umwandlung zu Nutzenergie (nach der innerbetrieblichen Umwandlung und Verteilung) bereitgestellten Energie, welche im folgenden als Einsatzenergie bezeichnet wird. Endverbrauch an Energieträgern (gemäss Statistik Bundesamt
für Energiewirtschaft): In der Gesamtenergiestatistik der Schweiz
des BEW werden auf der Stufe des Endverbrauches gemäss obiger
Definition alle vom Verbraucher (Konsumenten) bezogenen Primär-
und Sekundärenergieträger erfasst. Im Endverbrauch nicht
enthalten sind die Verteilverluste und der Eigenverbrauch bzw. die
Umwandlungsverluste des Energiesektors. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Energie, als Wirtschaftsgrösse | Der Begriff Energie wird nicht nur in seiner physikalischen Bedeutung verwendet, sondern auch im Sinne einer Wirtschaftsgrösse (Energie als Marktprodukt, als Produktionsfaktor, als Motor der Wirtschaft). Der Begriff der Energie als Wirtschaftsgrösse steht im vorliegenden Kompendium im Vordergrund, im Bewusstsein jedoch, dass der Umfang des Energieverbrauches stets auch ein Indikator für die Belastung unserer Umwelt ist. | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Energie, Begriff | Energie als physikalischer Begriff bedeutet Vorrat an Arbeitsvermögen. Energie wird auch als Fähigkeit eines Systems bezeichnet, äussere Wirkung hervorzurufen (Max Planck). Summe aus Arbeitsvermögen und Abwärme (in Joules [J]
gemessen). siehe auch "Energie, Masseinheit" |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] Energie-Fachbuch 1995 [13.2, Seite 240] |
||
| Energie, Erscheinungsformen der | Energie tritt in verschiedenen Erscheinungsformen auf, z.B. als mechanische Energie (Energie der Lage und der Bewegung), thermische Energie (Wärme), chemische Bindungsenergie, elektrische Energie, elektromagnetische Strahlungsenergie oder Kernenergie. Energie kann gespeichert werden; sie kann auch umgewandelt werden und dabei Träger und Erscheinungsform wechseln (z.B. beim Speicherkraftwerk: Umwandlung der potentiellen mechanischen Energie von gespeichertem Wasser in elektrische Energie). Energie kann jedoch weder “erzeugt” noch vernichtet werden. Der Begriff “Energieerzeugung” ist allerdings in der Praxis durchaus gebräuchlich. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Energie, Graue | siehe graue Energie | |||
| Energie, Masseinheit | Internationale Masseinheit der Energie ist heute das Joule (J); früher war auch die Kalorie (cal) gebräuchlich. 1 Joule (J) = 1 Wattsekunde (Ws) Siehe auch Umrechnung Einheiten |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Energie, Weisse | Die weisse Energie umfasst alle konventionellen Energieträger und Energiequellen (Uran, Oel, Gas, Kohle, Bioenergie, Holz, Erdwärme, usw.) | Energie-Fachbuch 1995 [13.2, Seite 240] | ||
| Energie, Wertigkeit der | Unter hochwertiger Energie versteht man Energie, die möglichst
vollständig in andere Energieformen umgewandelt werden kann.
Mass für die Qualität oder Wertigkeit von Energie ist
die Exergie: Als Exergie bezeichnet man jenen Anteil der Energie,
der in andere Energieformen umwandelbar ist; der nicht weiter umwandelbare
Energieanteil heisst Anergie. Bei jedem energetischen Prozess nimmt
die Exergie ab und die Anergie zu; insgesamt bleibt die Energie
jedoch konstant: Mechanische Energie und elektrische Energie z.B. sind sehr hochwertige Energieformen (100% Exergie); sie können vollständig in Wärme umgewandelt werden. Wärme hingegen kann nur teilweise in andere Energieformen umgewandelt werden; Wärme enthält also einen nicht umwandelbaren Anteil Anergie (der Wärmeinhalt eines Körpers, dessen Temperatur nur sehr wenig höher liegt als die Umgebungstemperatur, besteht z.B. fast vollständig aus Anergie). Für eine optimale Nutzung der Primärenergie muss bei jeder Energieumwandlung der Exergieverlust möglichst klein gehalten werden. Unter diesem Gesichtspunkt ist es z.B. nicht zweckmässig, hochwertige Elektrizität direkt für die Erzeugung von Niedertemperaturwärme zu verwenden. Grundsätzlich gilt dies für alle hochwertigen Energieträger, also auch für Oel und Gas. Energetisch sinnvoller ist es also z.B. mittels hochwertiger Energie und einer Wärmepumpe niederwertige Umgebungswärme zu nutzen. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Energieholz | Holz, welches direkt zur Gewinnung von Wärme genutzt wird. Zum Beispiel: Stückholz, Schnitzel, Späne. | Abgeleitet aus der Erklärung des Wortes Biomasse. | ||
| Energiequellen (erneuerbare) | Wirtschaftlich nutzbares Energiedargebot aus kontinuierlichen, in der Natur ohne menschliches Zutun auftretenden Energieumsetzungsprozessen (z.B. Sonnenenergie, Erdwärme). | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Energiesystem (in der Energiewirtschaft und Energietechnik) | Technisch-wirtschaftliches Gesamtsystem, das zur Energieumsetzung (Energiegewinnung und -verteilung, Energieanwendung) dient. Je nach Betrachtungsweise ergibt sich eine andere Abgrenzung des Energiesystems. | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Energietechnik | Teil der Technik, der die Nutzbarmachung (Gewinnung), Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie zum Gegenstand hat. | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Energieträger | Alle Stoffe bzw. physikalischen Erscheinungsformen von Energie, aus denen direkt oder durch eine oder mehrere Umwandlungen Nutzenergie bzw. Energiedienstleistungen gewonnen werden können. Energieträger sind z.B. Erdgas, Elektrizität, Dampf. Die Begriffe “Energieträger”,"Energiearten", “Energiequellen” und “Energie” werden häufig undifferenziert nebeneinander verwendet. | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Energieumformung | Gewinnung von Energie unter Wahrung der physikalischen Erscheinungsform des Energieträgers (z.B. Umformung von Wechselstrom in Gleichstrom) jedoch unter Entstehung von Umformungsverlusten. | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Energieumwandlung | Gewinnung von Energie unter Aenderung der chemischen oder physikalischen Erscheinungsform des Energieträgers und unter Entstehung von Umwandlungsverlusten. Beispiele: Umwandlung von Wasserkraft in Elektrizität; Umwandlung von Brennstoffenergie in Dampf; Umwandlung von Elektrizität in Licht. Die Güte einer Energieumwandlung ist nicht nur eine Frage
der Quantität (reiner Kilowattstundenvergleich zwischen der
im Umwandlungsprozess eingesetzten und gewonnenen Energie), sondern
auch eine Frage der Qualität |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Energieumwandlungs- verluste, Energieumformungs- verluste |
Differenz zwischen der in einem Umwandlungsprozess oder zur Umformung eingesetzten und der gewonnen Energiemenge. Zur richtigen Bewertung der Verluste müssen die eingesetzten und die gewonnenen Energiemengen in dieselbe Energieeinheit umgerechnet werden. Beispiel: In einem gasgefeuerten Heizkessel wird mit einer Gasmenge von 1'000 m3 eine Wärmemenge (Heisswasser) von 8 MWh gewonnen. Der Brennwert des Gases wird mit 36.6 MJ/Nm3 (Ho) angegeben. 36.6 MJ/m3 (Ho) = 33 MJ/m3 (Hu)
|
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Energieverluste (allgemeiner Begriff) | Der aus einem Energiesystem austretende, nicht im Sinne des Prozesses genutzte Teil der zugeführten Energie. Energieverluste ergeben sich als Umformungs- und Umwandlungsverluste sowie als Verteilungs- und Übertragungsverluste. Energieverluste sind zum Teil physikalisch bedingt unvermeidbar, zum anderen Teil durch technische Mittel und persönliches Verhalten beeinflussbar und in gewissen Grenzen vermeidbar. Zur eindeutigen Kennzeichnung eines Energieverlustes müssen die Abgrenzung des betrachteten Energiesystems und die betrachtete Zeitperiode angegeben werden. | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Energievorkommen | Gesamtheit der in der Natur vorhandenen und mit technischen Mitteln
gewinnbaren erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Energien. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Energievorräte (nicht erneuerbare) | Bekannte und vermutete nicht-erneuerbare Energievorkommen, weLche wirtschaftlich nutzbar sind (z.B. Vorräte an Kohle, Erdöl). | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Entspannungsdampf | Dampf, welcher bei der Entspannung (das heisst Verringerung des Druckes) einer Flüssigkeit entsteht. Entspannungsdampf bildet sich nur, wenn der Sättigungsdampfdruck der Flüssigkeit höher ist, als der Druck, welcher die Flüssigkeit umgibt. Der Sättigungsdampfdruck ist abhängig von der Art und der Temperatur des Stoffes. Bei der Entspannung kühlt sich die Flüssigkeit auf die dem Umgebungsdruck zugehörige Sattdampftemperatur ab. Die abgegebene Wärmemenge wird benötigt um den Entspannungsdampf zu bilden. Siehe auch Nachdampf. | |||
| Erneuerbare Energie (regenerierbare, regenerative Energie) | Als erneuerbare Energie bzw. Energiequellen (oft auch regenerierbare oder regenerative E.) bezeichnet man Energie, die sich auf natürliche Weise entweder kontinuierlich oder in Zyklen (z.B. Jahreszyklus oder einige Generationen) erneuert. Die Energiequellen können dabei vollständig oder nur teilweise erneuerbar sein. (Nicht erneuerbare Energien sind anderseits Energien, die sich nicht oder nur in Erdgeschichtlichen Zeiträumen erneuern, z.B. die fossilen Brennstoffe). Für die Schweiz grundsätzlich von Bedeutung sind folgende erneuerbaren Energiequellen:
Vom unerschöpflichen, teilweise sehr grossen Potential an erneuerbaren Energiequellen lässt sich jedoch unter den gegebenen technischen, wirtschaftlichen und oekologischen Bedingungen bzw. Einschränkungen nur ein kleiner Teil sinnvoll nutzen. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Ethanol-Alkohol | Wird aus Fermentation und anschliessender Destillation von zuckerhaltigen Pflanzen (z.B. Zuckerrohr) gewonnen. Ethanol kann mit Erdölderivaten zur Gewinnung von synthetischen Treibstoffen vermischt werden. | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Exergie (Arbeitsvermögen) | Teil der Energie, welcher mechanische Arbeit zu leisten vermag | Energie-Fachbuch 1995 [13.2, Seite 240] | ||
| F |
|
|||
| Fossile Energieträger | Energieträger organischer Herkunft, welche in erdgeschichtlichen Zeiten entstanden sind, Insbesondere Erdöl (bzw. Erdölprodukte), Erdgas und Kohle (Steinkohle, Braunkohle). Die fossilen Energieträger deckten 1990 rund 75% des gesamten Energieverbrauches in der Schweiz (Endenergieverbrauch). Im Hinblick auf die beschränkten Ressourcen (nicht- erneuerbare Energie) und die mit der Nutzung entstehende Umweltbelastung kommt der sparsamen und rationellen Verwendung der fossilen Energieträger im Rahmen der Energiepolitik hohe Priorität zu. | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| G |
|
|||
| Geothermische Energie (Erdwärme) | Die Geothermie nutzt die im Erdinnern gespeicherte Wärmeenergie.
Das Potential an Erdwärme ist sehr gross. Die Dichte des vom
Erdinnern zur Erdoberfläche gerichtete Erdwärmestromes ist
jedoch relativ gering (ca. 0.06 j/M2. s). Nutzungsmöglichkeiten
bestehen daher vor allem dort, wo die Wärmequelle konzentriert
und leicht zugänglich ist, bei heissen Gesteinsformationen, die
mit Wasser oder Dampf gefüllt sind. Man unterscheidet geothermische
Vorkommen niedriger und hoher Temperatur. Die Quellen niedriger Temperatur
können zur Raumheizung genutzt werden. Vorkommen hoher Temperatur
( 150 °C) können zur Elektrizitätserzeugung und für
Prozesswärmeanwendungen genutzt werden. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| gesättigter Dampf | siehe Dampf | |||
| Graue Energie (Energieinhalt eines Produktes) | Als “Graue Energie” bezeichnet man die insgesamt zur Herstellung eines Produktes direkt und indirekt aufgewendete Energiemenge, gemessen am Produktionsort (Energieinhalt des fertigen Produktes selber, Energieverbrauch für den Produktionsprozess einschliesslich Energieinhalt der im Produktionsprozess verbrauchten zusätzlichen Materialien). Der Begriff “graue Energie” wird u.a. benutzt, um den Energieinhalt importierter oder exportierter Produkte, die selber keine Energieerzeugnisse (Energieträger im engeren Sinn) sind, zu beschreiben. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| H |
|
|||
| Heissdampf | siehe Dampf | |||
| Holzkohle | Wird aus der langsamen und unvollständigen Verbrennung von Holz gewonnen. | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| I |
|
|||
| J |
|
|||
| K |
|
|||
| Kernenergie | Energie, welche aus einem Kernbrennstoff gewonnen wird. Der Kernbrennstoff
ist ein Material, das einen oder mehrere Spaltstoffe enthält,
welche eine Kettenreaktion aufrechterhalten können (z.B. Uran
235). |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Kondensation | [spätlat. >Verdichtung<] die, -/-en, 1) Chemie: chem. Reaktion, bei der sich zwei Moleküle des gleichen Stoffs oder versch. Stoffe unter Abspaltung eines Moleküls einer chemisch einfachen Substanz (z.B. Wasser, Ammoniak) zu einem größeren Molekül vereinigen. Eine einfache Kondensation liegt z.B. bei der Herstellung eines Esters aus einer organ. Säure und einem Alkohol vor. Bei bifunktionellen Verbindungen kann sich die Kondensation vielfach wiederholen (Polykondensation); auch intramolekulare Kondensationen sind hier möglich (diese laufen i.d.R. unter Bildung einer Ringverbindung ab).- Die Kondensation ist für die präparative Chemie, die Polykondensation in der techn. Chemie für die Herstellung von vielen Kunststoffen von großer Bedeutung. 2) Physik: der Übergang eines Stoffs vom gasförmigen in den flüssigen bzw. festen Aggregatzustand beim Überschreiten der (zur herrschenden Temperatur gehörenden) Sättigungsdichte seines Dampfes infolge Abkühlung bis auf die druckabhängige Kondensationstemperatur (Kondensationspunkt) oder infolge Druckerhöhung. - Die bei der Kondensation frei werdende Kondensationsenthalpie (ältere Bez. Kondensationswärme) hat den gleichen Betrag wie die Verdampfungs- bzw. Sublimationsenthalpie, die beim Übergang vom flüssigen bzw. festen Aggregatzustand in den gasförmigen aufzubringen ist. - Die Kondensation setzt gewöhnlich nur dann beim Überschreiten der Sättigungsdichte ein, wenn auch die flüssige bzw. feste Phase des Stoffs oder Kondensationskerne vorhanden sind; andernfalls erfolgt ein Kondensationsverzug, es tritt eine Übersättigung des Dampfes auf. Die Kondensation des Wasserdampfes der Atmosphäre führt zur Bildung von Nebel, Wolken, Tau; die Abkühlung erfolgt beim Einströmen wasserdampfreicher Luftmassen aus wärmeren Gebieten in kältere, durch Wärmeabstrahlung oder durch Ausdehnung von Luftmassen beim Aufsteigen. |
Brockhaus - Die Enzyklopädie: in 24 Bänden. Verlag: © F.A. Brockhaus GmbH, Leipzig - Mannheim | ||
| Kondensationswärme | Die bei konstanter Siedetemperatur abgeführte Wärme. | |||
| Kondensator | 1) Elektrotechnik, Elektronik: Vorrichtung zur Aufnahme elektr. Ladung. Ein K. besteht aus je 2 flächenhaften Leitern, die durch ein Dielektrikum voneinander getrennt sind. Die Kapazität hängt von der Leiterfläche, ihrem Abstand und der Art des Dielektrikums ab. Der K. hat die Eigenschaft, Gleichstrom zu sperren. 2) Vorrichtung bei Dampfturbinen, die den Abdampf zu Wasser verdichtet. 3) Wärmeaustauscher in Kältemaschinen, in dem der verdichtete Kältemitteldampf unter Wärmeabgabe an Kühlwasser oder Kühlluft verflüssigt wird. |
Der Brockhaus in einem Band, 9. vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. | ||
| L |
|
|||
| Leistung | Als Leistung bezeichnet man den auf eine Zeiteinheit bezogenen Energieumsatz (Leistung = Energie pro Zeiteinheit). Masseinheit der Leistung ist das Watt (W). 1W = 1 J/s. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| M |
|
|||
| Methanol-Alkohol | Wird durch chemische Synthese nach Vergasung von kohlenstoffhaltigen Stoffen (z.B. Holz) gewonnen. Lässt sich zu synthetischen Treibstoffen weiterveredeln. | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| N |
|
|||
| Nachdampf | Der bei der Nachverdampfung entstehende Dampf. | |||
| Nachverdampfung | Verdampfung bei Druckerniedrigung. Wird eine Flüssigkeit oder ein Flüssigkeits- Dampfgemisch (z.B. Kondensat nach den Austritt aus einem Kondensatableiter oder Kältemittel nach den Austritt aus dem Einspritzventil) adiabatisch expandiert, so ergibt sich eine Nachverdampfung. Es verdampft soviel Flüssigkeit, bis der Gleichgewichts- oder auch Sättigungsdampfdruck p im Gesamtvolumen wieder eingestellt ist. Die adiabatische Expansion vom Anfangsvolumen V1 auf das Volumen V2 ist mit einer Erniedrigung der Temperatur von T1 auf T2 verbunden. Siehe auch Entspannungsdampf. | |||
| Nutzenergie | Die Energie, die dem Energieanwender nach der letzten Umwandlung (am Ausgang der energieverbrauchenden Geräte, z.B. an der Antriebswelle des Motors, am Heizkörper im Zimmer) in der für den jeweiligen Zweck benötigten technischen Form zur Verfügung steht. Die Nutzenergieformen werden in der Regel wie folgt gegliedert: Wärme / Kälte, mechanische Arbeit, Licht, Chemie (chemisch gebundene Energie), Nutzelektrizität (z.B. für den Betrieb von EDV Anlagen). Anmerkung: Nutzenergie ist meist nicht eindeutig bestimmt, da verschiedene Abgrenzungen der Energieverbrauchssysteme möglich sind, Nutzenergie kann zudem nicht oder nur schwer gemessen werden. Der Nutzenergieverbrauch muss daher aus dem Verbrauch an Einsatzenergie oder Endenergie unter Verwendung von durchschnittlichen, meist geschätzten Nutzungsgraden berechnet werden. Der Begriff der Nutzenergie und die Verwendung von Nutzenergiegrössen bei quantitativen Betrachtungen sollten daher möglichst vermieden werden. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Nutzungsgrad der Energieumwandlung (eines Energiesystemes) | Allgemein: Verhältnis der in einem bestimmten Zeitraum vom System (z.B. Verbrauchsgerät) nutzbar abgegebenen Energie zu der dem System zugeführten Energie. Der betrachtete Zeitraum kann Pausen-, Leerlauf-, Anfahr und Abfahrzeiten mit einschliessen. | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Nutzungsgrad der Umwandlung Endverbrauch-Nutzenergie gemäss schweizerischer Gesamtenergiestatistik | Die in der Schweizerischen Gesamtenergiestatistik angegebenen Nutzungsgrade
der Umwandlung Endverbrauch - Nutzenergie nach Verbrauchergruppen,
Anwendungsgebieten und Energieträger beruhen auf Angaben von
Herstellern von Verbrauchsapparaten, Untersuchungen über tatsächlich
im Betrieb erzielte Werte und Statistiken über die im Gebrauch
stehenden Apparate. Die Angaben sind mit einer erheblichen Unsicherheit
behaftet. (Die Nutzungsgrade gemäss Gesamtenergiestatistik -
dort als ‘Wirkungsgrade" bezeichnet - schliessen alle Energieverteil-
und Umwandlungsverluste des innerbetrieblichen Energieversorgungssystems
ein). Für die Umwandlung Elektrizität - Nutzenergie im Industriesektor
nimmt die Energiestatistik beispielsweise folgende mittleren Nutzungsgrade
an: Nutzenergie Wärme: 0.77; Nutzenergie Mech. Arbeit: 0.84; Nutzenergie Licht: 0.1. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| O |
|
|||
| Oberer Heizwert Ho (Brennwert) | Wärmemenge, die bei vollständiger Verbrennung einer Mengeneinheit eines Brennstoffes (kg, m3) frei wird, wenn das bei der Verbrennung gebildete Wasser flüssig vorliegt und die Verbrennungsprodukte bis auf die Bezugstemperatur von 25 °C (ISO Bedingungen) abgekühlt werden. Unterer und oberer Heizwert sind um den Wärmeinhalt des im Rauchgas enthaltenen Wasserdampfes verschieden. Anmerkung: Der von den Gaswerken publizierte Heizwert von Erdgas ist in der Regel der obere Heizwert Ho. Ebenso werden die Erdgaspreise bezogen auf den oberen Heizwert (Brennwert) angegeben (Fr/MWh Ho). Für energetische Kostenrechnungen und Kostenvergleiche werden die Gaspreise zweckmässigerweise auf MWh Hu bezogen. Für die Umrechnung Ho/Hu gilt (Faustformel): unterer Heizwert Hu
|
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| P |
|
|||
| Photovoltaikanlage | Eine Photovoltaikanlage wandelt das Sonnenlicht direkt in Strom um. In den meisten Fällen sind diese Anlagen dezentral auf Dächern installiert und speisen die Elektrizität ins öffentliche Stromnetz ein. Siehe auch Solarzelle. | Coop Zeitung, Nr. 20; 18. Mai 2005; Seite 81 | ||
| Primärenergie (Rohenergie) | Energieträger, die man in der Natur vorfindet und welche noch keiner Umwandlung oder Umformung unterworfen wurden, unabhängig davon, ob sie in dieser Rohform direkt verwendbar sind oder nicht; also Energie in jenem Ausgangszustand, wie er für die wirtschaftliche Nutzung zur Verfügung steht. Z.B. Erdöl, Erdgas, Steinkohle, Uran, Laufwasser, Brennholz und andere Biomasse, Sonneneinstrahlung, Wind, Umgebungswärme (Umweltenergie), Erdwärme. Die Primärenergie wird gewöhnlich unterteilt in die nichterneuerbaren und die erneuerbaren (regenerativen) Energieträger. Anmerkung: In der Schweizerischen Gesamtenergiestatistik wird unter der (importierten) Primärenergie die Kernenergie als die mit Kernenergie erzeugte Reaktorwärme erfasst. Statistisch werden zudem Müll und Industrieabfälle ebenfalls zur (inländischen) Primärenergie gezählt. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Q |
|
|||
| R |
|
|||
| Ruths-Speicher | [nach dem Schweden Johannes K. Ruths, * 1879, † 1935], ein Wärmespeicher (Gefällespeicher). Beim Ruths-Speicher wird Abdampf aus Dampfkraftanlagen in heisses Wasser geblasen, mit dem ein gut wärmeisolierter Stahlbehälter zu 90 % gefüllt ist. Der Dampf kondensiert im Wasser und heizt es auf. Der Behälterinnendruck und die Temperatur steigen, sodass sich das Wasser stets im Siedezustand befindet. Beim Öffnen des Ventils entsteht infolge des Druckabfalles Dampf, bis sich Druck und Temperatur wieder im Gleichgewicht befinden. | Brockhaus - Die Enzyklopädie: in 24 Bänden. Verlag: © F.A. Brockhaus GmbH, Leipzig - Mannheim | ||
| S |
|
|||
| Sattdampf | siehe Dampf | |||
| Sättigungsdampfdruck | Gleichgewichtszustand zwischen Flüssigkeit und Dampf. Der Sättigungsdampfdruck hängt von der Art des Stoffes und der Temperatur ab | |||
| Schwaden | Dampf, Dunst | Duden | ||
| Schwadendampf | Dieser Ausdruck wird in der Dampfwirtschaft (bei Wasserdampfanlagen
im Anlagenbau) für Dampf verwendet , welcher
die Anlage verlässt und als Schwaden in die Atmosphäre
geht (z.B. bei offenen Kondensatbehältern oder bei Speisewasserentgaser).
|
|||
| Sekundärenergie | Energie, die durch Umwandlung aus Primärenergie oder aus anderer
Sekundärenergie (unter Entstehung von Umwandlungsverlusten) gewonnen
wurde, und für die weitere Umsetzung bzw. Nutzung zur Verfügung
steht. Beispiele: Erdölprodukte (Heizöl, Benzin, Dieselöl, etc.), Flüssiggas, Koks, Biogas, Elektrizität, Fernwärme, Abwärme. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Siedetemperatur | Temperatur, bei der eine Flüssigkeit zu sieden beginnt. Eine Flüssigkeit siedet, wenn der Gesamtdruck in ihr gleich ihrem Sättigungsdampfdruck für die betreffende Temperatur ist. Bei dem äusseren Druck 1.01 bar und vernachlässigbaren sonstigen Drücken ergibt sich so die normale Siedetemperatur oder der Siedepunkt. | |||
| Solarchemische Kraftwerke | Solarchemische Kraftwerke nutzen die konzentrierte Solarstrahlung, um chemische Reaktionen anzutreiben. Die dabei entstehenden Stoffe setzen in einer anderen chemischen Reaktion wieder Energie frei. | Coop Zeitung, Nr. 20; 18. Mai 2005; Seite 81 | ||
| Solarthermische Kraftwerke | Solarthermische Kraftwerke konzentrieren die Solarstrahlung über ein Spiegelsystem und produzieren mit der Wärme Wasserdampf. Dieser treibt wiederum Turbinen an, die Strom produzieren. | Coop Zeitung, Nr. 20; 18. Mai 2005; Seite 81 | ||
| Solarzelle (Photovoltaische Zelle) | Vorrichtung, welche unter Ausnutzung des inneren Photoeffektes Sonnenstrahlung
direkt in elektrische Energie umwandelt. In der Praxis werden mehrere
Zellen zu einem Modul verarbeitet und verschiedene Module zu grösseren
Einheiten zusammengefügt (Photovoltaische Anlage). (Ganz kleine
Anlagen werden z.B. für die isolierte Stromversorgung kleiner
Leistung eingesetzt (z.B. Telekommunikation, Aufladen von Batterien).
Etwas grössere Anlagen haben typischerweise Leistungen um 3 kW.
Ein grosses Sonnenkraftwerk von 500 kW Leistung ist ca. in den Jahren
um 1990 auf dem Mt. Soleil in Betrieb genommen worden.) Siehe auch Photovoltaikanlage. |
|||
| Sonnenenergie (Solarenergie) | Unter Sonnenenergie bzw. Nutzung von Sonnenenergie verstehen wir im engeren Sinn die direkte Nutzung der Sonnenstrahlungz.B. mittels Sonnenkollektoren (Wärme) oder Solarzellen (Strom). Sonnenenergienutzung im weitesten Sinn bedeutet jedoch grundsätzlich auch die indirekte Nutzung der Sonneneinstrahlung, bei welcher gespeicherte Sonnenenergie umgewandelt wird. Beispiele: Solare Strahlung bewirkt Verdunstung, Niederschlag und Schneeschmelze; daraus ergibt sich die Wasserkraftnutzung. Die Erwärmung von Erdoberfläche und Atmosphäre gestattet die Nutzung von Umgebungswärme in einer Wärmepumpe; usw. Man unterscheidet auch aktive und passive Sonnenenergienutzung. Bei der aktiven Sonnenenergienutzung wird die eingestrahlte Sonnenenergie mit einem Kollektor zunächst auf ein Wärmeträgermedium übertragen und dann der Nutzung zugeführt. Bei einem System der passiven Sonnenenergienutzung werden Bauteile so gestaltet, dass sie direkt zur Nutzung der Sonnenenergie beitragen (z.B. zweckmässig ausgerichtete Fenster). |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Sonnenkollektor | Vorrichtung, welche die einfallende Sonnenstrahlung einfängt
und, im allgemeinen, in thermische Energie umwandelt und diese an
ein Wärmeträgermedium abgibt. Im Absorber wird die Sonnenstrahlung
absorbiert, in Wärme umgewandelt und diese auf ein Wärmeträgermedium
übertragen, welches die thermische Energie abführt. Als
Wärmeträger- bzw. Wärmetransportmedium dienen z.B.
Luft, Wasser oder Oel. Sonnenkollektoren produzieren Wärme, die normalerweise zur Wassererwärmung oder zur Heizungsunterstützung genutzt werden kann. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] und Coop Zeitung, Nr. 20; 18. Mai 2005; Seite 81 | ||
| T |
|
|||
| U |
|
|||
| überhitzter Dampf | siehe Dampf | |||
| Umgebungswärme (Umgebungsenergie, Umweltenergie) | Die aus Sonnenenergie (oder auch aus Abwärme z.B. aus Industrie oder Haushalt) in der Luft, dem Oberflächenwasser und Grundwasser und dem Erdboden aufgenommene und gespeicherte Wärmeenergie wird als Umgebungswärme (auch Umgebungsenergie oder Umweltenergie) bezeichnet. Die Nutzung der Umgebungsenergie zur Raumheizung oder Warmwasserbereitung erfordert die Zuführung zusätzlicher Energie, um sie auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen. Dies kann mit Hilfe einer Wärmepumpe geschehen. | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Unterer Heizwert (Hu) verschiedener Energieträger | Die Heizwerte sind abhängig von der Qualität des Brennstoffes, die hier angegebenen Heizwerte sind daher ungefähre Werte. Siehe z.B. EMPA-Jahresmittelwerte - Heizöl extraleicht 1)
1) 1 l = 0.84 kg (Die Gaswerke geben den Heizwert des Erdgases als oberen Heizwert Ho an; für die Umrechnung Ho/Huu siehe Oberer Heizwert Ho)
|
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Unterer Heizwert Hu (Energieinhalt eines Brennstoffes) | Wärmemenge, die bei vollständiger Verbrennung einer Mengeneinheit
eines Brennstoffes (kg, m3) frei wird, wenn das bei der
Verbrennung gebildete Wasser dampfförmig vorliegt und die Verbrennungsprodukte
bis auf die Bezugstemperatur von 25 °C (ISO Bedingungen) abgekühlt
werden. Bei energetischen Berechnungen ist der untere Heizwert zu verwenden. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| V |
|
|||
| Verdampfen | Allg. der Vorgang der Verdampfung; speziell das in der therm. Verfahrens- und der Trocknungstechnik mithilfe von Verdampfern durchgeführte Trennen fester und flüssiger Stoffe. | |||
| Verdampfung | Übergang eines flüssigen oder festen Stoffs in den gasförmigen Zustand (Verdunstung, Sieden, Sublimation). | |||
| Verdampfung | Die Überführung einer Flüssigkeit, manchmal auch eines Feststoffes (Sublimation ), in den gasförmigen Aggregatzustand durch Wärmezufuhr. Handelt es sich um die V. eines Lösungsmittels aus einer Lösung, spricht man auch von Konzentrieren (Eindampfen ). Die aus der Flüssigkeit austretenden Moleküle müssen sowohl die Kohäsionskräfte als auch den Außendruck überwinden. Die dazu notwendige kinetische Energie erhalten sie durch die zugeführte Verdampfungswärme. Da bei der V. im Vakuum der Außendruck vermindert ist, können die Moleküle die Flüssigkeit schon mit geringerer kinetischer Energie verlassen, so dass die zugeführte Wärme kleiner sein kann. Ist der über der Flüssigkeit vorhandene Dampfdruck gleich dem Systemdruck, so siedet die Flüssigkeit und verdampft. Ist der Dampfdruck dagegen kleiner, spricht man von Verdunstung . Beim technischen Prozess der V. eines Lösungsmittels wird die Lösung bis zum Sieden erhitzt und der entstehende Brüdendampf kondensiert. Die V. des Lösungsmittels kann in Einkörper- oder Mehrkörperanlagen (Kaskadenverdampfung) betrieben werden. Zur V. gibt es zahlreiche Apparatetypen (Verdampfer). In ihnen befindet sich die Lösung meist in einem Rohrbündel, während der Dampf im Zwischenraum des Bündels kondensiert. Für schonende Behandlung der zu konzentrierenden Stoffe werden Dünnschichtverdampfer verwendet. Sie haben einen senkrechten, z. T. konischen Apparateteil, an dessen Innenwandung die einzudampfende Lösung herabrieselt. Die Oberfläche des Flüssigkeitsfilms wird durch die starren oder beweglichen Wischer eines eingebauten Rotors mit senkrechter Achse ständig erneuert. Auch Zerstäubertürme werden zum Eindampfen von Lösungen verwendet. |
Lexikon der Chemie. Spektrum Akademischer Verlag GmbH | ||
| Verdampfung | 1) Thermodynamik: isothermer Phasenübergang flüssig-gasförmig als Vorgang des Siedens an einer Oberfläche. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass aus der Oberfläche der Flüssigkeit mehr Moleküle heraustreten, als aus dem Dampfraum in die Flüssigkeit eintreten. Er erfolgt solange, bis der über der Flüssigkeit befindliche Dampf bei der Verdampfungstemperatur gesättigt ist. Zur Überführung der Moleküle in den Dampfraum ist Wärmeenergie, die Verdampfungswärme, erforderlich. Die beim Verdampfen aufgewandte Wärme wird bei der Kondensation als Kondensationswärme wiedergewonnen. 2) Kernphysik: Verdampfung von Nukleonen. |
Lexikon der Physik. Spektrum Akademischer Verlag GmbH | ||
| Verdampfungsenthalpie | Verdampfungsenthalpie, spezifische Verdampfungsenthalpie, früher spezif. Verdampfungswärme, Wärmemenge (in kJ), die benötigt wird, um 1 kg einer Flüssigkeit bei unverändertem Druck in Dampf gleicher Temperatur zu überführen. Siehe auch Verdampfungswärme. | Brockhaus | ||
| Verdampfungswärme | Die bei konstanter Siedetemperatur zugeführte Wärme. Siehe auch Verdampfungsenthalpie. | |||
| Verdunstung | Übergang einer Flüssigkeit in den gasförmigen Zustand ohne zu sieden. | |||
| W |
|
|||
| Wärmeträger (Wärmeträgermedium) | Stoff, der wegen seiner Eigenschaften besonders geeignet ist Energie in der Form von Wärme (thermischer Energie) zu transportieren oder zu übertragen (z.B. Heisswasser, Dampf, Thermoöle, etc.). | Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| Wasserkraft | Potentielle Energie (Lageenergie) der Gewässer. Wasserkraft
wird insbesondere zur Stromerzeugung genutzt. Der Anteil der Wasserkraftwerke an der schweizerischen Landeserzeugung (Strom) betrug im Jahre 1990 rund 56%. |
Grundbegriffe Energie-Wirtschaft [13.1] | ||
| X |
|
|||
| Y |
|
|||
| Z |
|
| Weitere, zusätzliche Informationen: |
|
| -> | Weitere Fachausdrücke können Sie im Lexikon nachschlagen (z.B. Begriffe der Lüftungstechnik) |
| -> | Was gibt es für Ventilatorhersteller? Wo bekommen ich einen
Tropfenabscheider? Wer liefert Kältemaschinen? |
| -> | Links zu Themen der Energie- und Gebäudetechnik (z.B. zum Thema Wärmepumpen oder Solarenergie) siehe Links. |
| -> | Optimierungen von Lüftungs- und Klimaanlage siehe Optimierungsprojekte. |
Für die Stichwortsuche nach einem bestimmten Thema verwenden Sie die Suchfunktion. Es werden Ihnen alle Dokumente angezeigt, die dieses Stichwort enthalten.
Diese Übersicht / Tabelle, dieses Lexikon mit Grundbegriffen der Energiewirtschaft ist ein Service für die Kunden des Ingenieurbüro Dolder und die Besucher der Webseite www.dolder-ing.ch.
Das Ingenieurbüro Dolder bietet im Bereich der Energie- und Gebäudetechnik folgende Dienstleistungen an: Gesamtkonzepte, Gebäudetechnik-, HLK-, TGA-, HVAC- und Energieanlagenplanungen, Gebäudeautomation, Analysen, Messungen, Expertisen, Anlagenoptimierungen und Energieoptimierungen, Dokumentationen, Informations- und Wissensmanagement, Entwicklungen, Schulungen.
Das Ingenieurbüro Dolder ist tätig in den Bereichen / Fachgebieten Energie- und Gebäudetechnik, Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Druckluft, Dampfanlagen, Energieanlagen und Wärmerückgewinnung, DDC-, Analog-, und Pneumatik - Regulierungen sowie Gebäude- und Raumautomation.
Weitere Informationen zum Ingenieurbüro Dolder siehe Unternehmen, Dienstleistungen und Projekte.
| nach oben |
|
|
| Zurück | | Home > Wissen > Lexikon > Grundbegriffe der Energiewirtschaft |
Sitemap |
Suchen
Impressum | Datenschutz+Recht
![]()